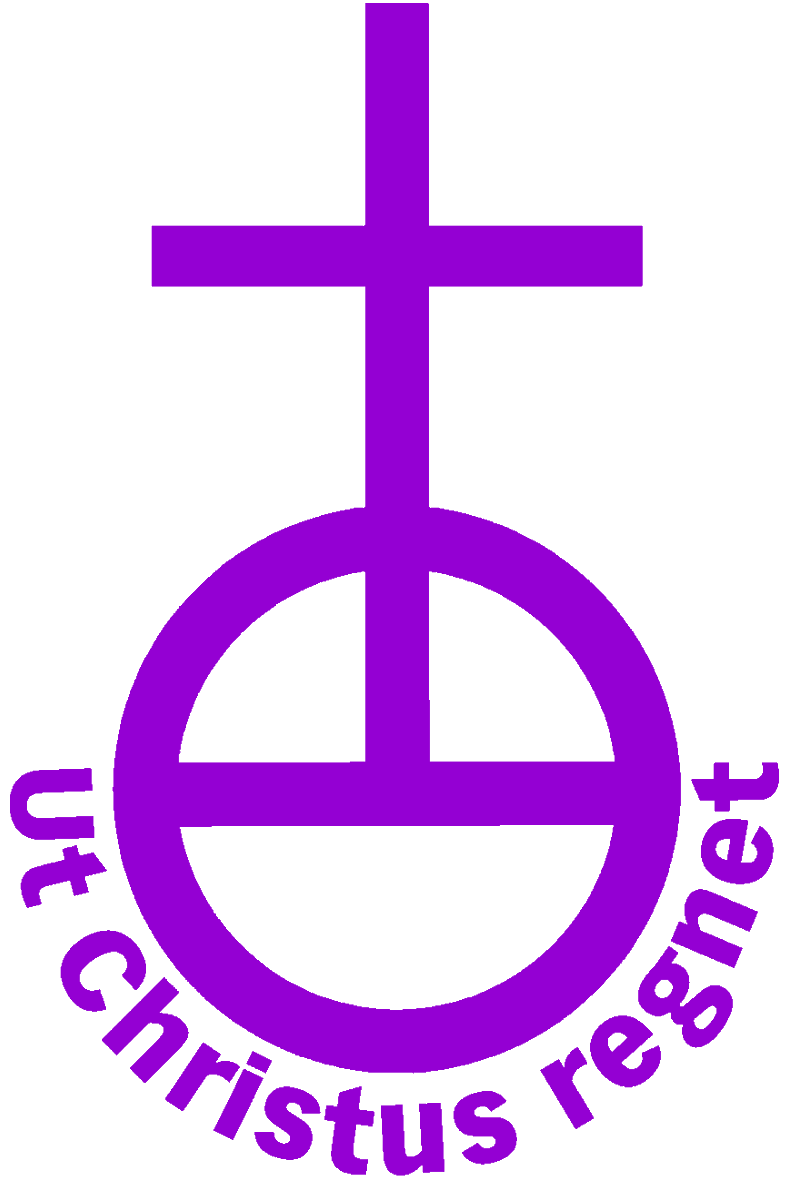

Jesus Christus spricht: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot ißt, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt.
Da stritten die Juden untereinander und sagten: Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben?
Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns eßt und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch.
Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken.
Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank.
Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.
Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch, wer mich ißt, leben um meinetwillen.
Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot ißt, der wird leben in Ewigkeit.
Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte.
Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede; wer kann sie hören?
Da Jesus aber bei sich selbst merkte, daß seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das?
Wie, wenn ihr nun sehen werdet den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war?
Der Geist ist's, der lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben.
Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wußte von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde.
Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben.
Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm.
Daß man uns in der Kommunität St. Michael als „hochkirchlich“ bezeichnet, ist bekannt. Wir gehen mit diesen Begriff nicht hausieren, weil er hierzulande fast völlig unbekannt ist. Eine Selbstbezeichnung zu verwenden, bei deren Verwendung man jedes Mal einen längeren Vortrag anfügen muß, ist kontraproduktiv.
Dennoch schämen wir uns dessen nicht, als "hochkirchlich" bezeichnet zu werden. Aber was ist darunter zu verstehen? Gibt es vom Wort Gottes her etwas dazu zu sagen?
Wir
meinen: Ja! Wir
wollen aber, wenn wir über den Begriff „hochkirchlich“ nachdenken, nicht hier
ansetzen, sondern viel lieber beim „Pietismus“.
Wir werden Erstaunliches entdecken, wenn wir die über „Pietismus und
Hochkirchlichkeit“ reden.
+++
Philipp
Jacob Spener gilt als „Vater des
Pietismus“. Er
war unter anderem lutherischer Oberpfarrer in Frankfurt am Main und lebte von
1635 bis 1705.
Im Jahre 1675 erscheinen sein Hauptwerk „Pia
Desideria oder Herzliches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren
evangelischen Kirche“.
Es enthielt das gesamte Reformprogramm des lutherischen Pietismus: Welt und
Kirche sollten verändert werden durch
veränderte Menschen. In einer Zeit, in der es nur um die reine
Lehre ging, ging
es Spener auch um die rechte Frömmigkeit. Sie besteht für ihn darin, mit Gott
unauflöslich verbunden zu sein in Zeit und Ewigkeit.
Folgende Aussage Speners steht im Evangelischen Gesangbuch beim Lied 288:
Was soll unsere allergrößte und beständigste Sorge sein? Daß wir im Leben, im Sterben und nach dem Tod, also in Zeit und Ewigkeit, mit Gott, als unserem alleinigen höchsten Gut, unzertrennlich vereinigt sein mögen.
In diesem Wort hat Spener das grundlegende Thema des Pietismus und dessen Anliegen zusammengefaßt. Pietistisches Anliegen ist demnach, „daß wir im Leben, im Sterben und nach dem Tod, also in Zeit und Ewigkeit, mit Gott, als unserem alleinigen höchsten Gut, unzertrennlich vereinigt sein mögen.“
Wir bekennen: Wenn das Pietismus ist, dann sind wir Pietisten. Aber: wenn das Pietismus ist, dann ist ja eigentlich jeder rechte Christ ein Pietist – oder er ist kein Christ mehr. Denn das ist ja der Inhalt des Christseins, „die Menschen an der Gemeinschaft teilhaben zu lassen, die zwischen dem Vater und dem Sohn im Geist der Liebe besteht“.
Wozu reden wir hier aber über den
Pietismus?
Weil unsere Wurzeln samt und sonders in
diesem
Pietismus sind. Wir brauchen uns dieser
Wurzeln nicht zu schämen. Und vor allem wollen wir sie nicht kappen! Unsere Wurzeln sind dort und dafür wollen wir
unserem Gott ewig dankbar sein.
+++
Nun gibt es aber uns betreffend einen anderen
Begriff, mit dem wir in Verbindung werden. Er lautet „Hochkirche“.
"Hochkirche" ist die Übersetzung des englischen Wortes "highchurch" bzw. "High
Church". Die
Englische (= Anglikanische) Kirche wird nämlich folgendermaßen unterteilt:
in die hochkirchliche Richtung, die "Hich Church". In dieser hochkirchlichen Ausrichtung schätzt man die Kirche hoch ein mit ihrer Lehre, ihrem Amt, ihren Sakramenten und Gottesdiensten.
gibt es die evangelikal-pietistische Low Church, die niederkirchliche Richtung. In ihr wird Gottesdienst und Kirche niedrig geachtet, die persönliche Entscheidung für Christus aber hoch geschätzt. Und dann gibt es noch
die Broad Church, die breitkirchliche Richtung. Die Broad Church könnte man etwa als die neutrale und liberale volkskirchliche Richtung bezeichnen.
Daß man die "Kommunität St. Michael" als hochkirchlich bezeichnen kann, könnte den Eindruck erwecken, daß wir als dem Pietismus entstammend eine Wendung von 180 ° gemacht haben. Daß wir nun etwas völlig anderes tun und glauben würden, als das, was wir vorher taten und glaubten. Wer auf das rein Äußerliche schaut, kann wohl zu dieser Meinung kommen.
Aber wer von denen, die uns nicht
wohlgesonnen sind, schaut schon wirklich hin oder versucht wenigstens, zu
verstehen?
Vielen genügt, was ihnen andere über uns erzählen. Und dann glauben sie jener
Mischung aus ganzen und halben Wahrheiten, aus Vermutungen, Gerüchten und
Beschuldigungen. In der Meinung, sie wären nun allumfassend informiert, sind sie
dann schnell fertig mit uns. Gegen solche Ohrenbläsereien ist man in der Regel
machtlos. Vor allem, wenn sie gar noch fromm verbrämt daherkommt. Wir wollen
jedoch uns "in allem als Gottes Diener empfehlen", auch "durch Ehre und Unehre,
durch böse und gute Nachrede".
+++
Pietistische Frömmigkeit heißt: im Leben, im Sterben und nach dem Tod, also in Zeit und Ewigkeit, mit Gott, als unserem alleinigen höchsten Gut, unzertrennlich vereinigt zu sein. Hat sich das für uns geändert? Nimmermehr! Unsere Wurzeln sind samt samt und sonders in diesem Pietismus und werden es bleiben.
Was hat das nun mit unseren hochkirchlichen Gottesdiensten zu tun?
Jesus Christus sagt: Mein Fleisch ist wahre Speise, und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm.
Die Gute Nachricht übersetzt:
Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm.
Das klingt wiederum sehr "pietistisch. Denn nach Spener ist das pietistische Anliegen " unsere allergrößte und beständigste Sorge ...daß wir im Leben, im Sterben und nach dem Tod, also in Zeit und Ewigkeit, mit Gott, als unserem alleinigen höchsten Gut, unzertrennlich vereinigt sein mögen."
Verwirklicht wird dieses Verbindung nach Jesu eigenen Worten durch das „Zerkauen“ des Leibes Jesu und das Trinken Seines Blutes.
Das
ist allerdings wiederum ein tatsächlich "hochkirchliches“ Anliegen, daß die Christen wirklich
Christi Leib und Blut ausgeteilt bekommen und nicht nur im symbolisch.
Jesus hat ja auch ausdrücklich gesagt, daß Fleisch und Blut wahre
Speise und Trank sind und nicht nur im spirituellen Sinn.
Hätte Jesus Sein Wort vom Zerkauen Seines Fleisches und Trinken Seines Blutes
lediglich symbolisch gemeint, dann hätte Er, als Ihn deswegen viele verließen
(Joh 6, 60+66) sagen können: "Petrus! Lauf schnell den Leuten hinterher und sage
ihnen, daß sie Mich vollkommen mißverstanden haben. Als Ich vom Essen Meines
Fleisches sprach und vom Trinken Meines Blutes, da habe Ich das doch gar nicht
wörtlich gemeint, sondern symbolisch und lediglich im übertragen Sinn."
Daß Jesus genau das nicht tat, sondern vielen Seiner Jünger ziehen ließ, zeigt: Jesus hat es genau so gemeint, wie Er es gesagt hat. Die Jünger, die Ihn damals verließen und dadurch aufhörten, Seine Jünger zu sein, hatten Ihn sehr richtig verstanden!
Nun wendet
allerdings mancher ein, daß in der großen Brotrede nicht vom Abendmahl die Rede
sein könne. Hat Jesus denn nicht in ihr gesagt, daß "das Fleisch nichts nütze"
(Joh 6, 63)?
Über diesen Einwand kann man sich nur wundern. Wenn mit “Fleisch“ in der
Brotrede nicht das Fleisch der Eucharistie gemeint sein soll, sondern zum
Beispiel die Predigt des Evangeliums, dann wäre ja dementsprechend die
Verkündigung des Wortes Gottes nichts nütze! Was wäre mit einer solchen
Umdeutung gewonnen?
Die Auslegung, daß die Worte Jesu "das Fleisch ist nichts nütze" sich auf Sein Fleisch beziehen würde, ist im Grunde unerträglich. Wäre es so, hätte Jesus selbst - kaum, daß Er es ausgesprochen hatte - sofort zurückgenommen, was Er kurz zuvor über die "Wirkung" des Kauens Seines Fleisches gesagt hat: Gemeinschaft mit Ihm und ewiges Leben.
Was soll man aber von solchen denken, die zwar nicht bestreiten, daß Jesus im
Fleisch kam, aber sagen, daß dieses Fleisch eigentlich nichts nützt. Es handelt
sich oft im Grunde genommen nur um immer neue Spielarten der Gnosis.
Daß das Fleisch Jesu nichts nütze, ist eine anti-christliche Meinung:
Ein jeder Geist, der bekennt, daß Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott;
und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, daß er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt.
Joh 4,2+3
Christlicher Glauben ist Glauben an Jesus Christus als dem fleischgewordenen
Wort, das "im Anfang" bei Gott war und von dem es heißt "Gott war das Wort."
Gnostischer Widerwillen gegen die Inkarnation (= Ein-Fleischung) Gottes begleitet die
Kirche Gottes von ihren Anfängen an. "Gnosis" lehrt (stark verkürzt) eine
strenge Gegensätzlichkeit der bösen Welt des Materiellen und der guten Welt des
Spirituellen. Erlösung ist Befreiung des Geistes von der Materie aufgrund von
„Erkenntnis“ oder „richtigem Wissen“ bzw. "richtigem Glauben". Die Erlösung
liegt nach dieser Auffassung also nicht im Leiden und Sterben Jesu, sondern in
der Zustimmung zu einer bestimmten Erkenntnis, einer Heilslehre.
Die Menschwerdung Gottes, deren entäußernder und erniedrigender Gipfel die
Hinrichtung Jesu am Kreuz war, ist das zentrale Ärgernis unseres Glaubens. Schon
in der Antike schien es Kritikern des Christentums als skandalös und Gottes
unwürdig, daß der jenseitige reine, absolute Geist (= Gott) sich mit Materie
beschmutzen haben sollte oder leibliche Dinge (Brot, Wein, Wasser, Öl, Worte aus
Menschenmund) in den Dienst der Heils-Mitteilung stellen sollte.
Dieses Denken ist nie ausgestorben. Der Widerspruch gegen die Lehre von den
Sakramenten ist derselbe, der gegen die Menschwerdung Gottes laut wird: Wie kann
Endliches Unendliches fassen? Der absolut jenseitige Geist und irdische Materie
– wie reimt sich das zusammen?
Gnostizistisch geprägte Christen können nicht glauben, daß Gott mit irdischen
und vergänglichen Dingen himmlischen und ewigen Segen gibt. Sie bestreiten
darum, daß ein Sakrament ein Mittel ist, durch das wir wirklich die Gnade
empfangen. Sie leugnen, daß es das sichtbare Zeichen einer nicht sichtbaren
Gnade ist, die in und mit dem Sakrament gegeben wird. Die Sakramente sollen
nicht mehr sein als unvollkommene äußere Symbole für innere Vorgänge des
geistlichen Lebens. Sie halten die Sakramente für das Bild oder die Darstellung
einer Gnade, die nicht an das (materielle) Zeichen gebunden ist und nicht durch
das sichtbare (materielle) Zeichen wirklich gegeben und mitgeteilt wird.
Wird die von Gott
gewirkte Tatsache der Anwesenheit göttlicher Gnade in den Elementen geleugnet,
müssen aber die Werke des Menschen machen, daß das Sakrament „gültig“ ist und der
Mensch die symbolisierte Gnade empfängt: zum Beispiel das Bekennen des Glaubens
(als Gehorsamsakt) bei der Taufe oder das An-Jesus-Denken beim Abendmahl.
Hier liegt m. E. die Quelle vieler Streitereien zwischen den Christen: Es ist
die unterschiedliche Antwort auf die Frage: "Wie hältst du es mit der
Inkarnation?"
+++
Die
Verwirklichung der hochkirchlichen Sehnsucht nach dem wahren Leib und Blut
Christi hat natürlich Konsequenzen auch in der Form der
Gottesdienste.
Auf den ersten Blick scheinen Äußerlichkeiten,
wie gesungene, feierliche Gebete und farbige Gewänder
das
Typische unserer Gottesdienste schlechthin zu sein. Aber: die Dinge, die anderen
ins Auge fallen und an denen sie sich vielleicht stoßen, deuten auf eine
dahinterstehende Wirklichkeit. Um diese Realität geht es allein.
Alles, was wir im Gottesdienst tun, tun wir weil wir wissen: ER SELBST ist da. Unser gottesdienstliches Tun kann Gottes Gegenwart nicht „machen“. Aber all unser gottesdienstliches Tun rechnet fest damit, daß ER SELBST da ist. Unser Gottesdienst ist ein Hineingehen in die Gegenwart des heiligen Gottes. Wir feiern jeden Gottesdienst als Audienz bei dem lebendigen Gott, in dessen Gegenwart die Seraphim und Cherubim ihr Gesicht verhüllen. Wir feiern die Gegenwart unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, der bei uns durch sein Wort und Sakrament gegenwärtig ist.
Darum sind unsere Gottesdienste sehr festlich gestaltet: Wir singen viele Lieder und liturgische Gesänge; die Diener tragen während des Gottesdienstes farbige liturgische Gewänder; auch sitzen wir nicht während der ganzen Zeit des Gottesdienstes, sondern vollziehen mit, was im Gottesdienst geschieht, indem wir uns erheben oder auch niederknien. Und da ist es egal, ob wir in einem Dom sitzen oder in einer kleinen Kapelle. Der sich herabließ, in einem Stall in die Welt einzugehen, der ist sich auch nicht zu schade, in einer kleinen Kapelle oder gar in einem Gottesdienst im Wohnzimmer zu den Seinen zu kommen um Gemeinschaft mit ihnen zu haben.
Die unzertrennliche Vereinigung mit unserem alleinigen und höchsten Gott zu haben ist aber auch das ursprüngliche Anliegen des Pietismus. In unseren feierlichen Gottesdiensten findet sich also die Synthese von pietistischer und hochkirchliche Frömmigkeit.
+++
"Hochkirchlichkeit" und "Pietismus" brauchen einander:
„Hochkirchlichkeit“ braucht dringend einen guten Schuß „Pietismus“, um sich zum Beispiel nicht im Ästhetischen oder Rituellen zu erschöpfen.
Wenn
aber andererseits Pietismus nicht wenigstens ein wenig durch Hochkirchlichkeit
korrigiert wird, geht er irgendwann fehl.
Warum? Der Pietist neigt immer ein
wenig zum Individualismus und übertriebenen Betonung persönlicher Erfahrungen
und Gefühle. Er bezieht seine Gewißheit oft nur aus subjektiven Erlebnissen
und Empfindungen. In gewisser Weise liegt das an der Rechtfertigungslehre
Luthers, nach der man gerechtfertigt wird, wenn man glaubt, daß man
gerechtfertigt wird.
Diese Lehre führt jedoch dazu, daß sich die Leute nur noch mit sich selbst beschäftigen, dazu, daß man Glauben mit Gefühl verwechselt, ständig den Finger an seinem „geistlichen Puls“ hat und dann in tiefe Anfechtungen gerät, aus denen man selbst eben s wenig herauskommt, wie man sich selbst nicht an den Haaren aus dem Sumpf ziehen kann. Denn wenn ich angefochten bin, glaube ich nicht vielleicht mehr, daß ich gerechtfertigt werde. Wenn ich aber nicht glaube, daß ich gerechtfertigt werde, werde ich nicht gerechtfertigt. Das stürzt mich wiederum in noch tiefere Anfechtungen.
Wenn man aber so an den eigenen Glauben glaubt und Heilsgewißheit aus dem eigenen innerlichen Brunnen schöpfen will und dann anstatt klaren Wassers trüben Schlamm aus seinem eigenen Herzen in seinem Glaubens-Eimerchen hochzieht, gibt es mehrere Möglichkeiten: man kann
-
verzweifeln und den ganzen christlichen Glauben fahrenlassen oder man kann
-
so tun, als wäre es nicht Schlamm und zum Heuchler werden oder man kann
-
in Zukunft mit seinem Eimerchen nur noch ein wenig an der Oberfläche schöpfen, damit man nichts vom Grund mit aufwirbelt.
Der "hochkirchliche Pietist" bzw. "pietistische Hochkirchler" aber tut das
-
und bessere. Er geht mit seinem Gefäß an eine lebendige Quelle klaren kühlen Wassers, die außerhalb von ihm liegt. Er schöpft seine Gewißheit nicht in sich, sondern außerhalb von sich. Er schöpft sie aus dem Wort Gottes, das von außen an ihn ergeht und den Sakramenten, die ihm von außen vor allem im Gottesdienst der Kirche Jesu Christi gereicht werden.
Darum denkt der "Hochkirchler" hoch von der Kirche. Er glaubt nicht an seinen Glauben und vertraut nicht auf die Gefühle und Stimmungen seines Inneren. Daß in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt, weiß er. Darum schaut er nicht in sein Inneres, sondern vertraut er lieber auf die Gnadenmittel, die sein Herr ihm mittels des Amtes der Kirche in Wort und Sakramenten gibt. Er weiß: Rettung und Heilsgewißheit kommen nicht von innen, sondern von außen. Im Gottesdienst der Kirche, der nichts anderes ist als die Verbindung von Wort und Sakrament, wird ihm handgreiflich und authentisch versichert:
-
daß er ein todwürdiger Sünder bin und
-
daß Jesus Christus wirklich genug für ihn getan hat. Er ist gerettet aus Gnade um Christi willen durch Glauben und das nicht aus sich selbst.
Und weil er nichts Gutes in sich findet und auch nicht seine Gewißheit, schätzt er die Dinge, die ihm Gewißheit verleihen hoch ein: die Kirche Gottes mit ihren Ämtern, das Wort Gottes und die Sakramente Gottes: kurz den Gottesdienst.
Hochkirchlichkeit ist die Erfüllung des Pietismus. Pietismus wiederum ist die Erfüllung der Hochkirchlichkeit. Pietismus hält uns dazu an, eine untrennbare Beziehung zu Jesus Christus zu suchen. Hochkirchlichkeit wiederum hält uns dazu an, diese Verbindung nicht in uns zu suchen, sondern durch Wort und Sakrament. Pietismus lehrt die persönliche Beziehung zu unserem Herrn, Hochkirchlichkeit schärft uns ein, das nicht außerhalb des Leibes Christi zu tun.
Es kommt daher nicht von ungefähr, daß sehr, sehr viele Hochkirchler dem Pietismus entstammen bzw. Hochkirchler sich dem Pietismus zuwandten. Namen wie Newman oder Dr. Echternach und andere seien hier genannt Auch der des Reichsgrafen Nikolaus von Zinzendorf. Der Begründer Herrenhuts und „Erfinder“ der Losungen hatte eine „hochkirchliche“ Bischofsweihe. Oder John Wesley, der Begründer der Methodistischen Kirche. Auch er gehörte als anglikanischer Geistlicher zur hochkirchlichen Richtung seiner Kirche.
Was soll unsere allergrößte und beständigste Sorge sein? Daß wir im Leben, im Sterben und nach dem Tod, also in Zeit und Ewigkeit, mit Gott, als unserem alleinigen höchsten Gut, unzertrennlich vereinigt sein mögen.